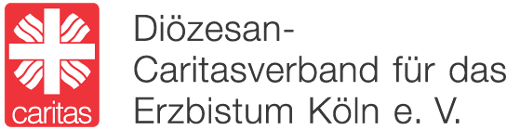Finanziell:
Nach der finanziellen Unterstützung durch Soforthilfen und der Unterstützung bei der Wiederbeschaffung von Hausrat hilft die Caritas den Betroffenen bei der Finanzierung des Wiederaufbaus des Wohneigentums.
Wiederaufbauhilfen:
Für den Wiederaufbau stehen in Nordrhein-Westfalen Mittel in Höhe von rund 12,3 Milliarden Euro aus dem Aufbaufonds 2021 bereit. Die Förderung erfolgt als Billigkeitsleistung in Höhe von bis zu 80 Prozent der förderfähigen Kosten. Für denkmalpflegerischen Mehraufwand beträgt die Billigkeitsleistung bis zu 100 Prozent.
Weitere Informationen sowie der Link zum NRW-Online-Antrag.
Nach Beantragung und Bewilligung von Landesmitteln können Betroffene Spendengelder bei der Caritas beantragen und zwar in Höhe von 20 Prozent der förderfähigen Kosten, also der sogenannte Eigenanteil, der nicht über Landesmittel finanziert wird. Für weitere Fragen nehmen Sie bitte Kontakt zu den Caritas-Fluthilfebüros in Ihrer betroffenen Region auf. Voraussetzung ist die Vorlage des Bewilligungsbescheids des Landes NRW.
Beratung – Begleitung und Vermittlung in Fachdienste
Probleme mit Versicherungen, ein aufwendiges Antragsverfahren, steigende Kosten und ein Mangel an Gutachtern und Handwerkern: Viele Betroffene sind psychisch und physisch am Rande ihrer Kräfte. Außerdem belasten das Erlebte und die wiederkehrenden Bilder und Geräusche die Psyche. Jedes Mal, wenn es stärker regnet, werden die Erlebnisse der Flut wieder lebendig und lösen Ängste und Panik aus. Erschöpfungszustände durch die teils anstrengenden körperlichen Aufräumarbeiten sowie fehlende Rückzugsmöglichkeiten und Erholungsphasen laugen die Betroffenen zusätzlich aus. Auf der Grundlage dieser Erfahrungen mit den von der Flut betroffenen Menschen ergänzen die Caritasverbände, SkF und SKM ihre Beratungsstellen um bedarfsorientierte Angebote in den Flutgebieten. Hier wird eine langfristige und kontinuierliche Unterstützung von Nöten sein.
Wie geht es weiter?
Die Hilfen rund um die Flutkatastrophe werden noch lange nötig sein. Die öffentlichen Fördermittel werden voraussichtlich bis ins Jahr 2026 zur Verfügung stehen. Neben der Unterstützung mit Spendengeldern entwickelt die Caritasauch Maßnahmen zur Quartiersarbeit und Sozialraumprojekte, denn Versammlungsmöglichkeiten, Jugendzentren, Begegnungsstätten wurden ebenfalls von der Flut weggeschwemmt. Gemeinsam mit den Betroffenen gilt es, das Gemeinwesen wieder zu stärken. Auch hier steht die Caritas an der Seite der Menschen vor Ort