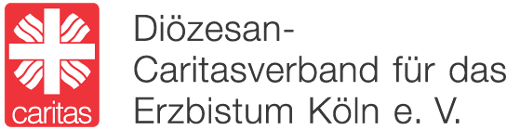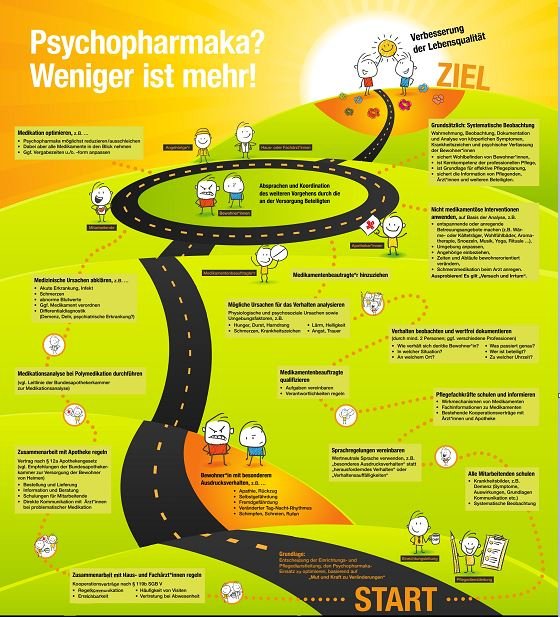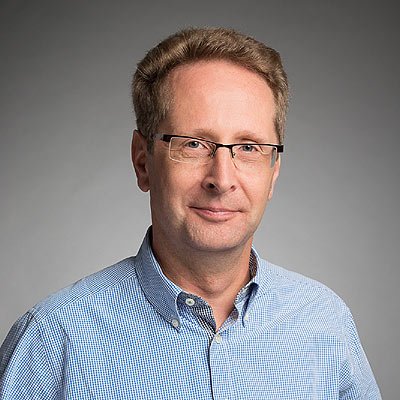Projekt STAP – Selbstbestimmt teilhaben in Altenpflegeeinrichtungen
Von Anfang 2017 bis Ende 2019 führte der Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln gemeinsam mit der Hochschule Düsseldorf unter dem Titel „STAP – Selbstbestimmt teilhaben in Altenpflegeeinrichtungen“ ein von der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW gefördertes Projekt durch, um systematisch die Rahmenbedingungen von Bewohnerinnen und Bewohnern in Altenpflegeeinrichtungen zu verbessern. Unter anderem sollte herausgefunden werden, welche Teilhabe-Wünsche bei den Bewohnerinnen und Bewohnern vorliegen und wie diese künftig besser erfasst und umgesetzt werden können.
2017 wurden in vier Caritas-Einrichtungen jeweils Interviews mit Mitarbeitenden sowie Bewohnerinnen und Bewohner und Angehörigen geführt. Anschließend fanden teilnehmende Beobachtungen statt. So wurden verschiedene Abläufe und Alltagsprozesse in den Blick genommen und verschiedene Alltagssituationen, Angebote, Ausflüge oder ruhige Momente in den Wohnbereichen beobachtet.
Im nächsten Schritt wurde das Interview- und Beobachtungsmaterial ausgewertet. Dadurch kann das Projekt auf differenzierte Hinweise und Praxisbeispiele zu Möglichkeiten und Grenzen der selbstbestimmte Teilhabe zurückgreifen. Alle Daten wurden im Zuge der Auswertung anonymisiert. Die Ergebnisse wurden den Projekteinrichtungen in Lernworkshops vorgestellt und mit den Leitungsverantwortlichen diskutiert. Außerdem fanden eine trägerübergreifende Gruppendiskussion und eine standardisierte Online-Befragung statt, in der auch andere (freie, öffentliche und private) Träger im Rheinland zur selbstbestimmten Teilhabe in Altenpflegeeinrichtungen befragt wurden.
Auf Basis der Ergebnisse wurde 2019 ein praxistaugliches Musterrahmenkonzept erarbeitet, in einer Einrichtung erprobt und anschließend evaluiert. Ziel ist ein Handlungsmodell für Mitarbeitende und Leitungskräfte zur Förderung einer selbstbestimmten, gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe für die Bewohner_innen, das sich auf Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Einrichtung bezieht.
Nähere Informationen zum Projekt erhalten Sie hier: www.stap-teilhabe.de
Das Musterrahmenkonzept liegt in zwei Versionen vor, nämlich als Leseversion und als Bearbeitungsversion.
Die Leseversion finden Sie hier.
Die Bearbeitungsversion finden Sie hier.
Außerdem wurde ein wissenschaftlicher Bericht zum Projekt verfasst, den Sie hier finden.
Nähere Informationen zum Projekt erhalten Sie hier: www.stap-teilhabe.de