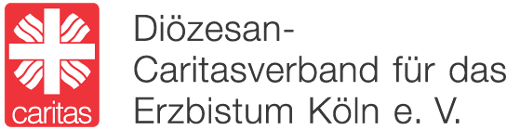- Über uns
- Wer wir sind
- Ansprechpersonen
- Überblick
- Direktion
- Geistlicher Beirat
- Referent für Caritaspastoral
- Schlichtungsstelle
- Datenschutz
- Stabsabteilung Fort- und Weiterbildung
- Stabsabteilung Information und Kommunikation
- Stabsabteilung Personal und Engagementförderung
- Stabsabteilung Recht
- Stabsabteilung Stiftungen und Fundraising
- Stabsabteilung Verbandskoordination/ Diözesanstelle SkF/SKM/IN VIA
- Bereich Gesundheits-, Alten- und Behindertenhilfe
- Bereich Kinder, Jugend und Familie
- Bereich Soziale Integration
- Bereich Verwaltung
- Bereich Wirtschaft und Statistik
- Diözesan-Arbeitsgemeinschaften
- Transparenzerklärung
- Umgang mit sexualisierter Gewalt
- Klimaschutz & Nachhaltigkeit
- KI & Innovation
- Datenschutz
- Vielfalt
- Kontakt & Anfahrt
- Leichte Sprache
- Themen
- Engagement
- Presse
- Karriere
- Hilfe vor Ort
-
Wenn das Spielen um Geld zum zentralen Taktgeber des Alltags wird
23.09.25, 09:34
- News und Pressemitteilungen Top-News für Startseite mit Bild

Köln – Am 24. September ist der bundesweite Aktionstag gegen Glücksspielsucht. Angelika Schels-Bernards ist Referentin für Suchthilfe beim Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln. Im Interview berichtet die Expertin, wann man von Glücksspielsucht spricht, welche Warnzeichen ernstgenommen werden sollten und welche Hilfsangebote es gibt.
Wann spricht man von einer Glücksspielsucht?
Glücksspielsucht – das ist nicht einfach „viel spielen“, sondern ein Kipppunkt: Wenn das Spielen um Geld zum zentralen Taktgeber des Alltags wird, wenn Gedanken, Gefühle und Handlungen sich zunehmend um den nächsten Einsatz drehen, wenn Verluste „gejagt“ werden, Verpflichtungen vernachlässigt, Beziehungen belastet und finanzielle Löcher größer statt kleiner werden. Das passiert oftmals heimlich, aber mit schwerwiegenden Folgen für ganze Familien.
Wie viele Menschen sind betroffen?
Bundesweit nahmen im vergangenen Jahr rund 36,5 Prozent der 16- bis 70-Jährigen innerhalb von zwölf Monaten an mindestens einem Glücksspiel teil; 12,2 Prozent spielten mindestens wöchentlich. Ausdrücklich risikoreiche Spielformen nutzten 6,9 Prozent.
Welche Spielformen sind denn besonders suchtfördernd?
Alles, was schnell, häufig und mit unmittelbarem Feedback belohnt, erhöht das Risiko – wie variable Gewinnpläne, kurze Runden und 24/7-Verfügbarkeit. In Deutschland gelten vor allem Geldspielautomaten, Online-Kasino-Spiele und Sportwetten als riskant; KENO zählt ebenfalls zur Risikogruppe.
Durch die Verlagerung ins Internet werden Glücksspielangebote auch leichter für Jugendliche nutzbar. Online-Spiele mit glücksspielähnlichen Mechaniken fördern zudem Verhaltensmuster, die klassischen Glücksspielprinzipien ähneln. Viele Fachleute sehen darin ein Einstiegsrisiko für spätere Glücksspielsucht und fordern deshalb strengere Kennzeichnungspflichten, Altersgrenzen und teilweise auch eine Regulierung wie bei echtem Glücksspiel.
Welche Warnzeichen sollten ernst genommen werden?
Steigende Einsätze und Spielzeiten; stetige Versuche, Verluste wieder einzuspielen; wiederholte, erfolglose Kontrollversuche; Lügen gegenüber Angehörigen; unerklärbare Schulden, häufige Mahnungen und mitunter heimliche Kredite sind ganz deutliche Warnzeichen in Familien und Partnerschaften, die ernst genommen werden sollten. Auch Entzugssymptome wie Unruhe oder Gereiztheit, wenn Spielen nicht möglich ist, oder der Rückzug aus Beruf, Schule und sozialen Kontakten. Wer sich oder seine Angehörigen in mehreren Punkten wiederfindet, sollte zeitnah professionelle Hilfe suchen.
Wo gibt es diese Hilfe?
Ein niedrigschwelliger Einstieg sind Selbsttests wie etwa „Check dein Spiel“ (www.check-dein-spiel.de). Dort können sich Menschen vergewissern, ob sie ein Suchtproblem haben. Die DigiSucht Online-Beratung kann kostenlos und auf Wunsch auch anonym genutzt werden (www.suchtberatung.digital). Die Suchtberatungsstellen der Caritas vor Ort bieten Glückspielberatung und Behandlung an. Alle Angebote sind vertraulich und in der Regel kostenfrei (www.caritasnet.de/onlineberatung/beratungsangebote/sucht/).
Was kann man selbst tun – besonders online?
Drei Schutzschirme haben sich bewährt. Erstens: Wissen und Selbstmonitoring wie Selbsttests, das Führen eines Spieltagebuchs, klare Zeit- und Geldbudgets, sofern keine Abstinenz angestrebt wird. Zweitens: technische Barrieren wie die bundesweite OASIS-Sperre – eine spielformübergreifende Selbst- oder Fremdsperre – und drittens temporäre Panik-Buttons in lizenzierten Online-Angeboten sowie harte Geräte- oder App-Sperren auf dem eigenen Endgerät. Nicht zu vernachlässigen sind auch soziale Anker wie das Gespräch mit einer Vertrauensperson und die Inanspruchnahme professioneller Unterstützung.
Das Interview führte Carolin Kronenburg.
Foto: Angelika Schels-Bernards, Referentin für Suchthilfe beim Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln (Credit: DiCV Köln)